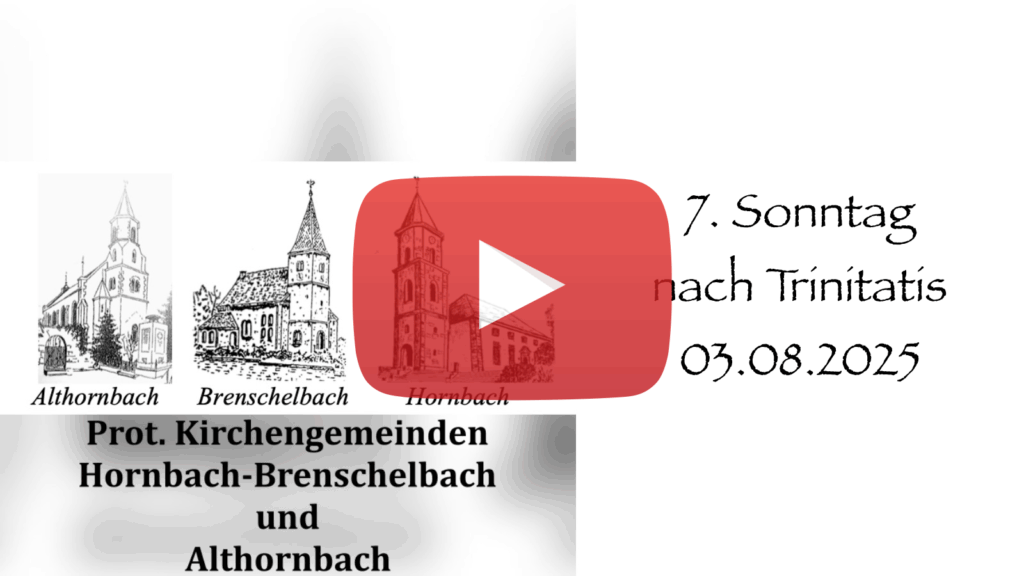Liebe Gemeindemitglieder der Kirchengemeinden Althornbach und Hornbach-Brenschelbach,
am 7. August 2025 haben die beiden Presbyterien unserer Kirchengemeinden jeweils einstimmig beschlossen ab dem 1. Januar 2026 zur Kirchengemeinde Hornbachtal zu fusionieren. Dies ist ein konsequenter Schritt im Rahmen einer schon seit vielen Jahren bestens funktionierenden Zusammenarbeit, die künftig weiter ausgebaut werden soll. Damit wenden wir uns aber auch gegen den allgemeinen Trend des Abbaus kirchengemeindlichen Lebens in ganz Deutschland und versuchen, die Kirche vor Ort zu stärken um auch in Zukunft im Namen Jesu Christi für die Menschen da zu sein. Wir wissen: auch in unserer Pfälzer Landeskirche stehen erhebliche Veränderungen an, an denen wir nicht vorbeikommen. Umso wichtiger ist es diesen Schritt zur Zusammenarbeit in christlicher Verbundenheit zu gehen und zu zeigen, dass wir eine gut funktionierende, mit Leben erfüllte Gemeinschaft sind, die modellhaft beweist, dass Kirche sich von unten nach oben aufbaut und nicht umgekehrt.
Unsere Zusammenarbeit betrifft alle Felder des gemeindlichen Lebens: die Kasualien Taufe, Hochzeit und Beerdigung, die Krabbelgruppe, den Religionsunterricht, die Jugendarbeit (inklusive Treffen, Konfirmand*innenarbeit und Freizeiten), aber auch die beliebten Formate Frauenfrühstück und Die Digger, die kulturellen und gottesdienstlichen Veranstaltungen und nicht zuletzt die gemeinsamen Feiern. Manches bleibt vor Ort, anderes können wir als eine vereinigte Kirchengemeinde besser anbieten, wenn wir es auf die Gemeindeteile verteilen.
Konfirmationen und Jubelkonfirmationen, Gottesdienste in neuer Vielfalt, ausdifferenziert für verschiedene Ziel- und Interessengruppen, Seelsorge oder Hausbesuche können so, im Team von Pfarrern, Lektoren und Ehrenamtlichen, den jeweiligen Bedürfnissen besser angepasst werden. Passend zum Hornbacher Frauenfrühstück soll zum Beispiel ein monatliches Treffen am Wochenende mit thematischen Schwerpunkten, Essen und Trinken für die ganze Familie in Althornbach angeboten werden. Wie unsere beliebte Frauenwandergruppe soll unsere Kirche unterwegs und zugleich an Ort und Zeit gebunden sein.
Durch die Fusion sind bei einer nunmehr größeren Gemeinde mehr Schlüsselzuweisungen zu erwarten. So können Baumaßnahmen und Investitionen gebündelt und finanziert, der Bestand der Gebäude vor Ort und ein vielgestaltiges Angebot ermöglicht werden – auch wenn gewiss schwierig werden wird, Kirche so zu transformieren, dass das Gute erhalten bleibt und zugleich den demographischen Bedingungen, den verschiedenen, zunehmend individuellen Glaubenseinstellungen, einer zeitgemäßen Frömmigkeitskultur und dem starken Bedürfnis nach Gemeinschaft und spirituellen Räumen Rechnung getragen wird. Vieles davon wird jetzt schon von einem begeisterten Team getragen, das wie selbstverständlich zusammenarbeitet.
Die kleinere der beiden Kirchengemeinden profitiert davon, dass sie überlebensfähig bleibt, die größere bekommt frischen Wind ohne Altlasten übernehmen zu müssen. Die Effektivität des Engagements, die geschwisterliche Verbundenheit, das selbstbewusste Auftreten gegenüber Tendenzen des Abbaus von Kirche werden durch die Fusion zur Kirchengemeinde Hornbachtal, der womöglich bald auch die Kirchengemeinde Rimschweiler beitreten wird,
nur gestärkt werden.
Lassen Sie uns also mutig und zuversichtlich die Wege gehen, die uns Gott durch Jesus Christus gewiesen hat und voller Freude gegen alle destruktiven Tendenzen die Kirche vor Ort erhalten und erneuern!
Mit besten Segenswünschen Ihr Pfarrer Daniel Seel